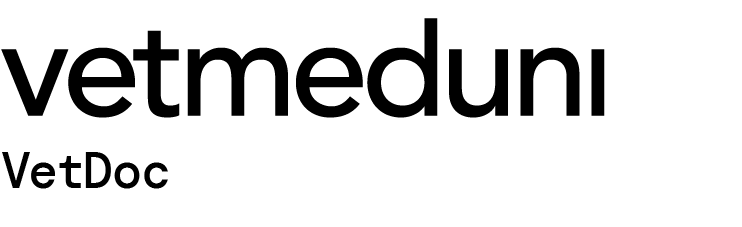Identification of cell populations in canine intestinal organoids and primary epithelium for modelling of acute and chronic gastrointestinal diseases.
Kurzbezeichung
Canine organoids for disease modelling.
Projektleitung an der Vetmeduni
Einrichtung Vetmeduni
Laufzeit
01.08.2022
-
30.04.2024
Projektkategorie
Einzelprojekt