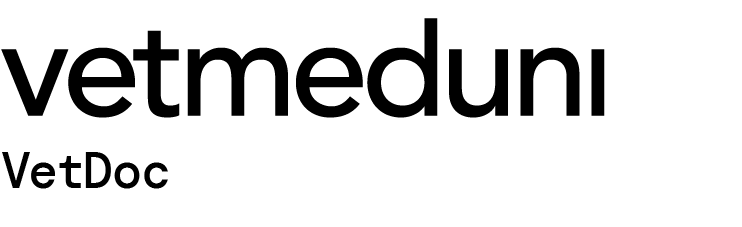The role of microgametes in the development of the porcine coccidium Cystoisospora suis and its interplay with the host
Kurzbezeichung
C. suis microgametes
Projektleitung an der Vetmeduni
Einrichtung Vetmeduni
Geldgeber
Laufzeit
01.01.2020
-
30.09.2024
Projektkategorie
Einzelprojekt