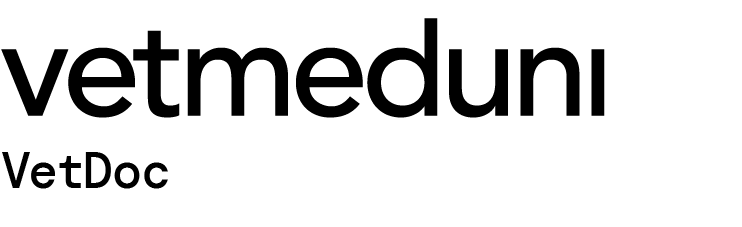Aggregationsmechanismen bei brutpflegenden Fischen
Kurzbezeichung
Breeding aggregations in fishes
Einrichtung Vetmeduni
Geldgeber
Laufzeit
01.05.2008
-
30.04.2013
Projektkategorie
Einzelprojekt