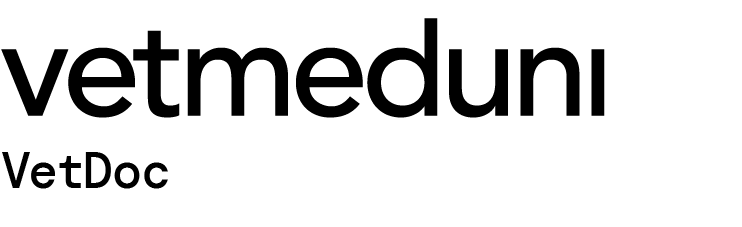Optimierung der Kontrolle von Fasciola hepatica, Ostertagia ostertagi und Dictyocaulus viviparus-Infektionen bei gealpten Rindern in Tirol/Österreich und Monitoring von Anthelminthikaresistenzen als Beitrag zur Ernährungssicherheit
Kurzbezeichung
F.O.O.D.-Alpenrind
Projektleitung an der Vetmeduni
Einrichtung Vetmeduni
Laufzeit
01.11.2022
-
31.05.2026
Projektkategorie
Einzelprojekt